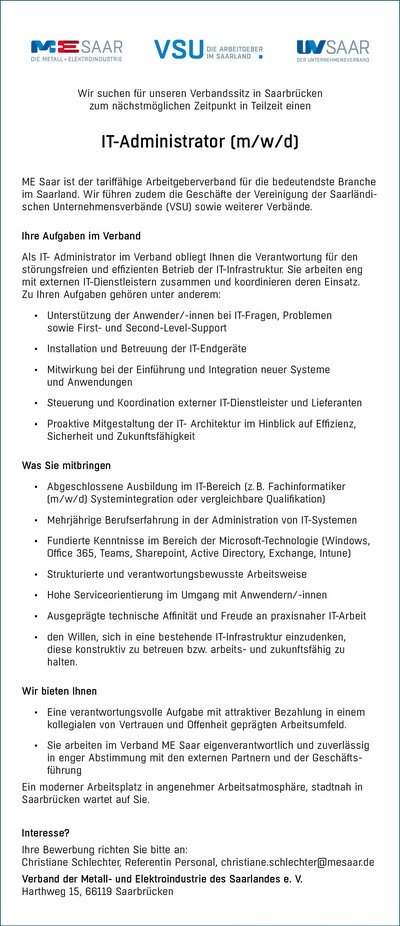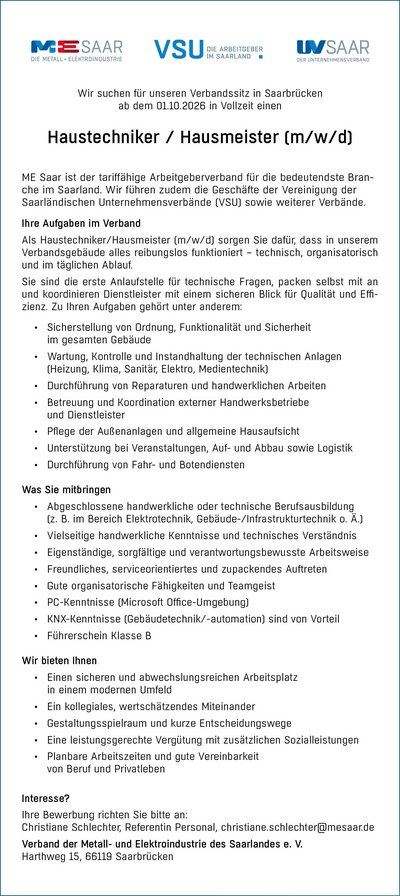Studie: Staat bringt geplante Investitionen nicht auf die Straße
Fifo: Fachkräftemangel und Bürokratie hemmen den geplanten Aufschwung

Foto: Adobe Stock/tuiphotoengineer
Eine aktuelle Studie des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts Köln (Fifo) unter dem Titel "Viel Geld erfolgreich ausgeben" lässt Zweifel am Plan des Bundes, die Infrastruktur mit Investitionen von über 100 Milliarden Euro zu sanieren. "Der schwierige Teil kommt jetzt, wenn es darum geht, die vielen PS auf die Straße zu bringen", sagt Studienautor Michael Thöne dem Handelsblatt. Tatsichlich sei es dem Bund bisher nicht gelungen, mehr als 60 Milliarden Euro an Investitionen pro Jahr umzusetzen. Grund dafür sind der Fachkräftemangel im öffentlichen Sektor, zu viele Hemmnisse bei öffentlichen Genehmigungen und Hemmnisse durch einen eng verflochtenen "Mehr-Ebenen-Staat". Um den Aufschwung zu erreichen, müssten Dutzende Regeln vereinfacht werden, die Kommunen finanziell wieder solide ausgestattet werden und Genehmigungen beschleunigt. Dazu müssten zahlreiche Fachkräfte eingestellt werden.
Deutsche Erwerbsbevölkerung sinkt in den kommenden 40 Jahren um 23 Prozent
OECD empfiehlt längere Lebensarbeitszeit zur Sicherung der Renten

Foto: AdobeStock/Valerii_Evlakhov
Die OECD warnt in ihrem Bericht „Pensions at a Glance 2025“ vor einer zunehmenden Herausforderung bei der Rentenfinanzierung in Deutschland. Aufgrund des schrumpfenden Erwerbspersonenpotentials wird eine längere Lebensarbeitszeit als wesentliche Maßnahme zur Stabilisierung der Renten gesehen.
Die deutsche Nettoersatzquote wird voraussichtlich nur 53,3 Prozent betragen, was unter dem OECD-Durchschnitt von 63,2 Prozent liegt. Angesichts der bereits hohen Steuer- und Abgabenquote in Deutschland betont die OECD, dass eine Anhebung des Rentenalters entscheidend sein könnte, um die Renten auch künftig zu sichern.
Arbeitgeber fordern ein Miteinander der Regierung statt Konfrontation
Deutliche Kritik an Aussagen der Bundesarbeitsministerin
Dass die Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas beim Juso Kongress zum Kampf gegen die Arbeitgeber aufruft, lässt Zweifel daran aufkommen, ob die aktuelle Bundesregierung tatsächlich den Ernst der Lage der Unternehmen erkannt hat. „Die jüngsten Äußerungen aus der Bundesregierung lassen Zweifel daran aufkommen, ob der Wert und die Unabhängigkeit der Sozialpartnerschaft allen Beteiligten bewusst sind", sagt Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger. Ein Aufruf zum Kampf gegen Arbeitgeber sei in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos und mit dem Grundverständnis einer gleichberechtigten Sozialpartnerschaft nicht vereinbar. "Die Behauptung, Arbeitgeber denken nur an sich, ist schlicht falsch. Und der Zuruf an die Arbeitgeber, die Rentenreform belaste Arbeitgeber nicht, weil sie aus Steuermitteln finanziert werde, ist ein offenkundiger ökonomischer Irrtum."
EuGH beendet Mindestlohn-Debatte
Ein einem Urteil hat der EuGH die 60-Prozent-Regel sowie weitere zentrale Vorgaben in der europäischen Mindestlohnrichtlinie gekippt. Damit ist eine Anpassung des deutschen Mindestlohn-Gesetzes vom Tisch. Das Gericht verneint zu Recht eine direkte europäische Kompetenz für die Festlegung einheitlicher Lohnuntergrenzen. Das sind gute Nachrichten für Deutschland, denn für das Mindestlohngesetz ergeben sich so keine neuen Anpassungspflichten.
Ihre Zukunft im Verband
ME Saar sucht IT-Administrator/in (m/w/d)
Sie brennen für IT-Technik und haben Erfahrung in der Administration von IT-Systemen?
Sie möchten dieses Wissen in einem Verband einbringen?
Dann sollten wir miteinander ins Gespräch kommen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit eine/n
IT-Administrator/in (m/w/d)
für die Verwaltung unserer IT-Infrastruktur.
Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie dafür begeistern können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich unter
Ihre Zukunft im Verband
ME Saar sucht Haustechniker/Hausmeister (m/w/d)
Sie übernehmen gerne Verantwortung, haben handwerkliches Geschick und haben Interesse daran,
mit dem Blick für das Wesentliche "den Laden am Laufen zu halten"?
Dann sollten wir miteinander ins Gespräch kommen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n
Haustechniker/Hausmeister (m/w/d)
für unseren Verbandssitz in Saarbrücken.
Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie dafür begeistern können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich unter
Oswald Bubel: Politik unterliegt einer Gelingens-Erwartung
VSU-Präsident appelliert an die Bundesregierung, endlich die Reform-Agenda umzusetzen

Foto: Kornfeld
Beim Saarländischen Unternehmertag hat VSU-Präsident erneut umfangreiche Reformen eingefordert. Sein Credo: Bürger erwarten, dass die Politik Probleme löst und Wohlstand sichert. Wenn diese diese Erwartung nicht erfüllt, orientieren sich die Wähler neu. Trotz positiver Impulse mit Steuererleichterungen, einer Modernisierungsagenda und schnelleren Verfahren, die großen Reformen unter anderem der Sozialversicherungen bleiben aus. Das Lieferkettengesetz bleibt bestehen, mit dem Tariftreiegesetz kommt neue Bürokratie. Der Befreiungsschlag für die Wirtschaft bleibt aus - und das in einer beispiellosen Wirtschaftskrise. Die VSU fordert eine Agenda 2030, die den Schwerpunkt wieder auf Innovation legt und nicht auf Richtlinien, Vorschriften und Verwaltung. Auf mehr Markt und weniger Mikro-Steuerung.
Die Preisträger des Bildungspreises der Saarländischen Wirtschaft 2025
Beispiele für Schulen, die in ihrer täglichen Arbeit mit innovativen Unterrichtsansätzen oder auch außerschulischen Initiativen, den Austausch, das kritische Denken und das Engagement der Schülerinnen und Schüler fördern.
Zwei saarländische Schulen sind im Jahr 2025 mit dem Bildungspreis der Saarländischen Wirtschaft ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) vergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert, die über die Stiftung des Verbands der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) finanziert werden. In diesem Jahr suchte die VSU Schulen, die mit innovativen Projekten einen besonderen Beitrag zur Förderung von Bildung und gesellschaftlicher Verantwortung leisten und sich dem Thema "Demokratiebildung" widmen.
lesen Sie weiter unter: https://bildungspreis.vsu.de/preistraeger-2025
VSU: Fairer-Lohn-Gesetz belastet öffentliche Haushalte und untergräbt Sozialpartnerschaft

Foto: Adobe Stock/Franceso Chiesa
Die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) sieht das geplante „Fairer-Lohn-Gesetz“ der Landesregierung höchst kritisch. „Das geplante Gesetz belastet nicht nur die öffentlichen Haushalte durch den Wegfall des Wettbewerbs, es untergräbt auch die Sozialpartnerschaft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern“, sagt VSU-Hauptgeschäftsführer Martin Schlechter. Die VSU wird das Gesetz, das jetzt in die Anhörung geht, aufmerksam prüfen.
„Das Grundgesetz gestattet es den Unternehmen und Gewerkschaften im Rahmen der Koalitionsfreiheit Arbeitsbedingungen auszuhandeln, ebenso garantiert es über die negative Koalitionsfreiheit, sich gegen eine Tarifbindung zu entscheiden“, sagt Schlechter. Es sei bedenklich, wenn die Politik sich gegen diese grundgesetzlich gesicherte Freiheit stellt und sich in die Tarifpolitik einmischt. Wenn Politik zugunsten einer Seite Arbeitsbedingungen bestimme und per Gesetz festlege, säge sie am bewährten Prinzip der Sozialpartnerschaft. Vielmehr sei es Aufgabe der Gewerkschaften, sich für ihre Mitglieder attraktiv zu machen und so von Arbeitnehmerseite den Rückhalt für die Verhandlungen mit Arbeitgebern zu erhalten. Ein „Fairer-Lohn-Gesetz“ wird vor allen Dingen die Kommunen als wichtiger Auftraggeber für öffentliche Investitionen belasten. Sie können ihren Zuschlag nun nicht mehr nach dem Prinzip der guten Haushaltsführung vergeben, sondern müssen erst mit erheblichem bürokratischem Aufwand prüfen, ob die jeweils vorgegebenen Tarifkriterien eingehalten werden.
Die VSU sieht in dem Gesetz außerdem eine unnötige Doppelstruktur. „Zum Schutz gegen Lohndumping gibt es den gesetzlichen Mindestlohn und in vielen Branchen einen Branchen-Mindestlohn“, sagt Schlechter. Saarländische Unternehmen, die öffentliche Aufträge ausführen wollen, müssen sich selbstverständlich daran halten.
Wirtschaftsministerium veröffentlicht Wachstumsagenda
Der Beraterkreis der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat eine Wachstumsagenda veröffentlicht.
Der Kreis, dem die Wirtschaftswissenschaftler Veronika Grimm, Justus Haucap, Stefan Kolev und Volker Wieland angehören, empfieht einen Weg zurück zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Dazu solle mehr Markt zugelassen und weniger Mikrosteuerung betrieben werden. Die Experten stellen Forderungen in fünf zentralen Handlungsfeldern auf:
- Innovation und Strukturwandel sollen ermöglicht werden.
- Staatliche Investitionen sollen in Zeiten knapper Haushaltsmittel gezielt eingesetzt werden.
- Deregulierung soll systematisch vorangetrieben werden.
- Die Sozialsysteme bedürfen einer grundlegenden Reform, um langfristig tragfähig zu bleiben. Ebenso soll die Steuerpolitik reformiert werden. Das Renteneintrittsalter soll angepasst, an die Lebenserwartung gekoppelt und der Nachhaltigkeitsfaktor gestärkt werden. Die Koppelung der Bestandsrenten an die Löhne wird als große Belastung für die Rentenversicherung beschrieben. Über die Indexierung an die Inflation sollte nachgedacht werden.
- Europäische Integration soll vertieft werden.
Damit beschreibt der Beraterkreis Kernforderungen der VSU, die diese mehrfach vorgetragen hat. Es sind Handlungsfelder, in denen die Bundespolitik dringend vorankommen muss.
Steuerdiskussion geht in die falsche Richtung
Höhere Steuern bremsen Investitionen

Foto: Adobe Stock/Marco2822
Die von der SPD angestoßene Diskussion über Steuererhöhungen geht in die falsche Richtung. Der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld warnt zu Recht davor, dass ein höherer Spitzensteuersatz vor allem Unternehmen belastet, weil diese vielfach unter die Einkommensteuer fallen. Deutschland verliert damit im Standortwettbewerb weiter an Attraktivität. Wenn bei Rekordeinnahmen das Geld nicht reicht, muss die Regierung das Naheliegende tun: Sparen.
Geplante Ausweitung der Mitbestimmung schlägt falschen Weg ein
Statt zu modernisieren, wirken neue Regeln lähmend
Mit ihrem Entschließungsantrag im Bundesrat haben mehrere Länder unter Beteiligung des Saarlandes eine Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung auf den Weg gebracht, die mehr lähmt als zu modernisieren. Statt Impulse für eine moderne, digitale Arbeitswelt zu setzen, schafft sie mehr Reglementierung, lähmende Verfahren und zusätzliche Bürokratie. Transformation wird auf diese Weise nicht gefördert, sondern blockiert. Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und technologische Offenheit sind für Unternehmen entscheidend. Wesentliche Punkte in der Entschließung des Bundesrats sind eine Ausweitung des Anwendungsbereichs, erweitere Mitwirkungsrechte beim Umgang mit Beschäftigtendaten, die Einführung eines Beratungsrechts bei Betriebsübergängen und die Regelung eines digitalen Zugangsrechts für Gewerkschaften. Mit den Regelungen sollen Betriebsräte zunehmend Einfluss auf strategische Entscheidungen der Unternehmen enthalten. Mitbestimmung kann aber nicht zu Fremdbestimmung werden, wenn die Unternehmer weiterhin das volle unterneherische Risiko tragen.
VSU begrüßt Steueranreize der Bundesregierung
Abschreibungsregeln können Investitionen anreizen

Foto: Adobe Stock/Marco2822
Mit höheren Abschreibungen und mittelfristig einer Senkung der Körperschaftssteuer bringt die Bundesregierung ein Investitionssofortprogramm auf den Weg. Aus Sicht der VSU ist dieses Programm ein positives Signal. Zwar nützen Abschreibungen nur Unternehmen, die auch Gewinne machen und auch die Körperschaftssteuer sinkt erst ab 2028, als erster Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist das Paket jedoch ein polistives Signal.
Konkret ist für drei Jahre eine degressiven Absetzung für Abnutzung (AfA) in Höhe von 30 % vorgesehen.
Die Körperschaftssteuer wird ab dem Jahr 2028 in fünf Schritten von jeweils einem Prozent abgesenkt.
Die Bruttopreisgrenze für die günstigere Besteuerung privat genutzte E-Dienstwagen steigt an.
Für Elektrofahrzeuge, die zwischen dem 30. Juni 2025 und dem 01. Januar 2028 angeschafft wurden, ist eine gesonderte dregessive Abschreibung möglich.
Die Forschungszulage wird ausgeweitet.
Im nächsten Schritt muss die Bundesregierung die Reform der Sozialversicherungen angehen, bei denen die Kosten aus dem Ruder laufen. Außerdem muss die Steuer- und Abgabenlast gesenkt werden. Wenn der Faktor Arbeit entlastet wird, setzt das auch einen Anreiz zur Steigerung des Arbeitsvolumens. Wesentliche Standortprobleme, insbesondere überbordende Bürokratie und Fachkräftemangel, sind weiter drängend.
Neue Regierung muss nun schnell Reformen auf den Weg bringen
Nach dem positiven Votum von Union und SPD zum Koalitionsvertrag ist es nun wichtig, dass die neue Regierung schnell Reformen auf den Weg bringt. „Der Koalitionsvertrag enthält bereits mehrere gute Elemente, die Investitionen anregen und die dringend notwendige Wirtschaftswende anstoßen können“, sagt Martin Schlechter, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU). Als Beispiele nennt er die hohen Sonderabschreibungen, die Senkungen der Energiepreise, die geplante Senkung der Körperschaftssteuer sowie einen umfassenden Bürokratieabbau. „Weitere dringend notwendige Schritte wie die Reform der Sozialsysteme vermissen wir im Koalitionsvertrag. Das ändert nichts daran, dass diese Regierung sie angehen muss, weil die hohen Arbeitskosten ein dauernder Wettbewerbsnachteil für unsere Unternehmen sind.“
Wirtschaftspolitik muss jetzt im Fokus stehen
VSU fordert schnelle Regierungsbildung
Nach der Bundestagswahl fordert die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) eine schnelle Regierungsbildung. „Angesichts der angespannten Lage dürfen die Parteien keine Zeit verlieren. Wir brauchen zügige Koalitionsverhandlungen und eine schnelle Regierungsbildung. Strukturreformen und eine umfassende Wirtschaftsagenda müssen dabei im Vordergrund stehen“, sagt Martin Schlechter, Hauptgeschäftsführer der VSU. „Über Monate sind wichtige Entscheidungen in vielen für die Wirtschaft bedeutenden Fragen liegen geblieben. Jetzt ist es an der Zeit, die nötigen Schritte beim Bürokratieabbau, der Energiesicherheit, der Kostenentlastung und bei der Sanierung der Infrastruktur anzugehen. Wir müssen unser Land modernisieren, um zu wirtschaftlicher Stärke zurückzukommen.“
Deutschland befindet sich im dritten Rezessionsjahr, die Arbeitslosigkeit geht in Richtung drei Millionen, Schlüsselindustrien sind auf dem Rückzug und Investitionen finden woanders statt. Der Standort ist in keiner guten Verfassung. „Wichtig ist nun, dass die demokratischen Parteien bei der Wirtschaftspolitik an einem Strang ziehen und nicht aus parteipolitischer Ideologie wichtige Reformen bremsen. Gerade die Wahlverliererin SPD muss nun über ihren Schatten springen“, sagt Martin Schlechter.
Angesichts der weltpolitischen Umwälzungen der vergangenen Wochen wird die Frage einer schnellen Regierungsbildung noch drängender. In der Geopolitik werden bisher bestehende Allianzen brüchiger. „Deutschland und Europa müssen wieder mit einer starken Stimme in der Welt auftreten. Dafür brauchen wir eine starke demokratische Mitte und ein Wachstumsprogramm, das unser Land voranbringt und die wirtschaftliche Basis stabilisiert. Wir hoffen, dass die künftige Regierung hierfür umgehend die richtigen Impulse und Rahmenbedingungen setzt.“
Unsere Forderungen an die künftige Bundesregierung - für einen starken Standort!
Die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland durchläuft eine Fehlentwicklung. Das jährliche Sozialbudget in Deutschland umfasst rund 1.250 Milliarden Euro. Die Sozialleistungsquote liegt bei über 30 Prozent. Deutschland hat sich von einem Sozialstaat zunehmend in einen Sozialhilfestaat entwickelt, der jegliches Lebensrisiko abzufedern versucht. Wir müssen uns wieder auf die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft besinnen, nach der Wirtschaft sich frei entfalten kann und die Gemeinschaft denjenigen Schutz zukommen lässt, die unverschuldet in Not geraten sind. Gleichzeitig muss Leistung wieder ein Wert sein, der von der Gesellschaft honoriert, aber auch gefordert wird. Allen Menschen müssen unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Entwicklungsmöglichkeiten offenstehen.
Die Sozialbeiträge haben längst die Grenze von 40 Prozent überschritten, die frühere Bundesregierungen als Belastungsgrenze für die Wirtschaft identifiziert hatten. Mit Beitragssteigerungen bei Kranken- und Pflegeversicherung sowie der noch von der Ampel-Regierung angestoßenen Rentenreform droht mittelfristig ein Anstieg auf 50 Prozent. Die nächste Regierung muss sicherstellen, dass der Anteil der Sozialbeiträge an den Arbeitskosten wieder unter 40 Prozent gedrückt wird. Um die Einsicht in die Notwendigkeit von Reformen zu fördern, sollte die Regierung regelmäßig über die Langfrist-Entwicklung der Sozialbeiträge berichten und so Transparenz schaffen.
Angesichts der prognostizierten Steigerung der Altenquote auf etwa 40 Prozent bis 2060 erfordert das Rentensystem künftig flexiblere Lösungen. Mit dem steigenden Lebensalter muss auch ein späterer Renteneintritt mit 70 diskutiert werden. Frühverrentungsanreize, die nicht nur teuer sind, sondern auch dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte entziehen, müssen wieder zurückgefahren werden. Das gilt vor allem für die Rente mit 63, die den Bundeshaushalt mit Milliarden belastet. Der Grundsatz Reha statt Rente sollte stärker in den Fokus genommen werden, um die Beschäftigungsfähigkeit möglichst lange zu erhalten. Hinzuverdienstmöglichkeiten bei vorgezogenem Rentenbezug sollten wieder wegfallen. Dagegen sollten Modelle entstehen, die das Weiterarbeiten nach dem Erreichen des Rentenalters attraktiver machen.
Die Reform des Gesundheitssystems sollte im Sinne der Wirtschaftlichkeit vorangetrieben werden. Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme, schneidet bei der Qualität aber regelmäßig unterdurchschnittlich ab. Strukturreformen sind hier überfällig. Um die Kosten zu senken und das Kosten-Leistungs-Denken stärker zu verankern, sollte auch wieder eine sozial abgefederte Eigenbeteiligung eingeführt werden. Auch das Pflegesystem kann nicht mehr als eine Teilleistungsversicherung bleiben und sich bei der Ausstattung am Machbaren orientieren.
Bürgergeld darf nicht attraktiver erscheinen als Erwerbsarbeit. Die Fehlentwicklung der vergangenen Jahre muss revidiert werden. Beim Bürgergeld muss wieder die Maxime eines ausreichenden Lohnabstandsgebots gelten. Menschen, die arbeiten, müssen bessergestellt sein als diejenigen, die nicht arbeiten. Das Bürgergeld darf deshalb nicht zu nah an die unteren tariflichen Entgeltgruppen heranreichen.
Die Kommunen in Deutschland sind strukturell unterfinanziert. Das größte Problem sind gesamtstaatliche Aufgaben, die einen Großteil der Kommunalfinanzen ausmachen, aber nicht ausreichend gegenfinanziert sind. Die Bundesregierung muss neben einem Kommunalentschuldungsprogramm die Finanzierung der Kommunen nach dem Prinzip „Wer bestellt, zahlt“ neu gestalten. Für Aufgaben, die den Kommunen vom Bund übertragen werden, müssen auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Eine erneute Verschuldungsspirale muss verhindert werden.
Arbeitsmarktpolitik muss effiziente Lösungen in einer sich verändernden Arbeitswelt schaffen und darf den Strukturwandel nicht durch zusätzliche Einschränkungen behindern. Deutschland steuert angesichts des demografischen Wandels auf eine gigantische Fachkräftelücke zu. Allein in der nächsten Legislaturperiode werden gut zwei Millionen mehr Menschen in den Ruhestand eintreten als junge Menschen in den Arbeitsmarkt. Ziel einer zukunftsgerichteten Arbeitsmarktpolitik muss es deshalb sein, das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen. Mittel dazu sind eine intensivierte und arbeitsmarktgesteuerte Zuwanderung, eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie eine Flexibilisierung der Arbeitsmodelle.
Nicht nur zum Antritt der Ampel-Koalition auch in der vergangenen Legislaturperiode ist der Mindestlohn immer wieder zum Spielball der Politik geworden. Eine politisch motivierte Anhebung des Mindestlohns führt zu einer Willkür bei der Lohnfestsetzung und in die Planwirtschaft. Der Mindeslohn gehört wieder in die der unabhängigen Mindestlohn-Kommission. Und die Politik muss zuverlässig zusichern, sich künftig bei diesem Thema zu enthalten. Nur so kann ein marktwirtschaftlich vertretbarer Mindestlohn entstehen.
Die Herausforderungen der Transformation und Klimapolitik erfordern staatliche Investitionen. Der Ruf nach einer Lockerung der Schuldenbremse ist der falsche Weg. Die Schuldenbremse wurde geschaffen, um in Zeiten knapper öffentlicher Mittel für eine Priorisierung zu sorgen. Die Politik muss dieser Aufgabe nachkommen, bevor sie über neue Schulden nachdenkt. Bereits jetzt begrenzt der hohe Zinsaufwand die Handlungsfähigkeit der Regierung. Zwischen 2021 und 2023 haben sich die Zinsausgaben von rund vier Milliarden auf knapp 40 Milliarden Euro verzehnfacht. Um die Ausgaben zu reduzieren, sind Reformen im Bereich Arbeit, Soziales und Wirtschaft überfällig.
Die deutsche Wirtschaft leidet unter übermäßiger Bürokratie. Sie ist ein Haupthemmnis für Investitionen und begrenzt die Unternehmen in ihrem Wachstum. In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind fast 2.200 neue Verwaltungsvorschriften geschaffen worden. Auf das Arbeits- und Sozialrecht entfallen davon fast 2.000 Regelungen. Viele Beschäftigte in den Unternehmen sind ausschließlich damit beschäftigt, Berichtspflichten zu erfüllen, ohne dass Wertschöpfung entsteht. Im internationalen Wettbewerb verlieren die Unternehmen an Boden, Investitionen verzögern sich oder werden ganz gestrichen.
Der Kampf gegen den Klimawandel gehört unbestritten zu den zentralen Aufgaben unserer Zeit. Diese Aufgabe wird aber nur gelingen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten bleibt. Klimapolitik muss sich unter Berücksichtigung der Welthandelspolitik am Machbaren ausrichten, nicht am Wünschenswerten. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden und damit fünf Jahre früher als es die Europäische Kommission für Europa vorschreibt. Dieser Weg erfordert massive Investitionen und bedeutet eine enorme Kraftanstrengung für die gesamte Gesellschaft. Klima- und Industriepolitik müssen unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit und sozialer Aspekte zusammengedacht werden.
In der öffentlichen Infrastruktur herrscht ein massiver Investitionsstau. Bund, Länder und Kommunen müssen einen dreistelligen Milliardenbetrag einsetzen, um Brücken, Straßen, Gebäude und Kanäle wieder auf den Stand der Technik zu bringen. Investitionsbedarf besteht auf allen Ebenen. Bei der Verkehrsinfrastruktur sind Straße, Schiene, Schifffahrt und Flughäfen gleichermaßen betroffen. Für die Umstellung auf E-Mobilität braucht Deutschland eine umfassende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur. Im Gebäudebereich reicht der Bedarf von Grundsanierungen bis hin zu einer energetischen und digitalen Ertüchtigung. Vor allem betroffen sind hier Schulen und Hochschulen, die zunehmend verfallen und keine zukunftsfördernden Lernorte darstellen. In diesem Zusammenhang ist es zwingend, dass der Bund die Länder und Kommunen finanziell so ausreichend ausstattet, dass diese ihrer Aufgabe gerecht werden können.
Ein Land ohne Rohstoffe kann im internationalen Vergleich nur durch Exzellenz seiner Fachkräfte und Forscher bestehen. Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte sind eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg der Unternehmen. Für eine erfolgreiche Transformation werden insbesondere kompetente MINT-Fachkräfte benötigt. Deutschland hat seine Führungsrolle hier längst verloren. Um den Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitern zu decken, muss deshalb auf allen Ebenen des Bildungssystems wieder ein hohes Qualitätsniveau sichergestellt werden.